[Potosí] „Der Berg, der Menschen frisst“ ist der bedrückende Name, den der „Cerro Rico“ seit dem 16. Jahrhundert trägt. Der Name dient auch als Buchtitel des spanischen Investigativ-Journalisten Ander Izagirre. In diesem Sachbuch begleitet er das junge Mädchen Alicia, das als Minderjährige im Jahr 2016 in den Minen des Berges arbeitet. Ausgehend von ihrer Geschichte dokumentiert er eindringlich und nachvollziehbar die heute noch aktuellen Ausbeutungsstrukturen vor Ort, die Profiteure im fernen Ausland und das Versagen der lokalen und nationalen Politik.
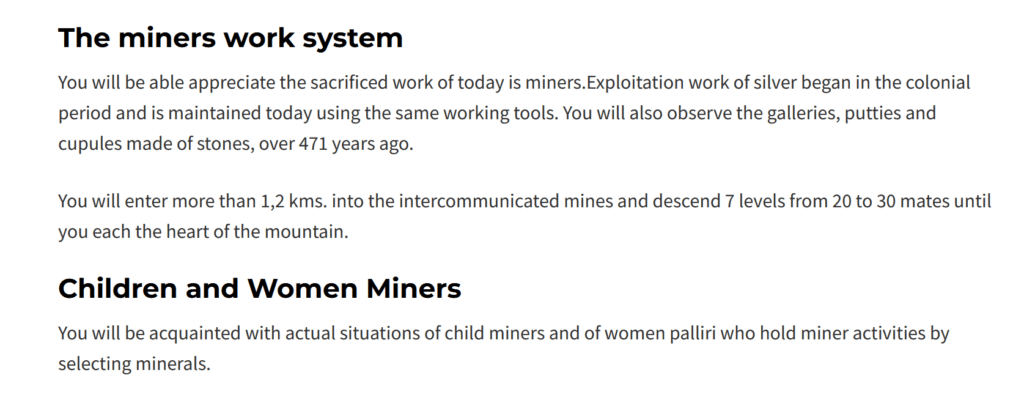
Izagirre zitiert die Kindernothilfe in Bolivien (CEPROMIN), die im Jahr 2011 ca. 13.000 Minderjährige in den Bergwerken gezählt hat. Bis heute arbeitet eine (unbekannte) Zahl an Minderjährigen in den Minen des „Cerro Rico“. Bis heute sterben jedes Jahr über 100 Minenarbeiter (jeden Alters) im Berg, der Menschen frisst. Im letzten Jahr (2024) waren es 106 Todesopfer. Und bis heute kann man als Tourist Touren buchen und das Minen-Prekariat in die (für Touristen besonders gesicherten) Minengänge begleiten. Es wird sogar damit geworben, dass man Frauen und Kinder bei der Minenarbeit beobachten kann (Beispiel Tourenanbieter, Stand März 2025). Wir haben bewusst auf dieses touristische „Highlight“ verzichtet, es wird leider aber bis heute stark nachgefragt.
Der Berg rächt sich für 500 Jahre Misshandlungen auf seine Art: 2011 brach seine Spitze ein und er gilt heute als akut einsturzgefährdet. „Pachamama“ (Mutter Erde) bzw. „El Tio” (Gott der Unterwelt und Patron der Bergleute) dürften der Ausbeutung von Natur, Berg und Menschen nicht mehr ewig tatenlos zusehen. Die Bergleute besänftigen die Gottheiten auf ihre Art: an jedem der 569 Schachteingänge findet sich ein Altar für den Onkel/ Gott „El Tio“, der mit Opfergaben wie Alkohol, Coca-Blättern, Zigaretten etc. befriedigt werden muss. Ein Brauch und Glaube, der bis heute tief in der einheimischen Bevölkerung verankert ist. „Pachamama“ schaffte in den letzten Jahrhunderten sogar eine Verschmelzung mit der Jungfrau Maria (wie so oft erweisen sich sowohl die katholische Kirche als auch die regionalen Gottheiten als sehr flexibel). In der ehemaligen Münzprägeanstalt Moneda sind Dutzende von Marienbildern bzw. christianisierte Pachamamas zu bestaunen, die die dreieckige Form des Berges „Cerro Rico“ aufnehmen und mit Hinweisen auf „Pachamama“ ausgeschmückt sind.


Die Situation der Minenarbeiter und ihrer Familien hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verbessert, mit der Aufgabe des staatlichen Betriebs und dem Wechsel zu privaten Genossenschaften eher verschlechtert. Die COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) betrieb alle Minen ab der Verstaatlichung im Jahre 1952, ging 1986 jedoch mit dem Einbruch der globalen Rohstoffmärkte in Konkurs, entließ 90% der Arbeiter und gab alle Minen bis auf eine auf. Heute arbeiten die Bergleute in Potosí in 39 Genossenschaften auf eigene Rechnung, ohne Sicherungsvorkehrungen und ohne moderne Technologie, ohne planende Ingenieure und ohne abgestimmte Bohr- und Sprengpläne. Der Staat verdient über die COMIBOL dennoch an der prekären Minenarbeit, da die Genossenschaften Lizenzen erwerben.

Der (in Westeuropa naheliegende) Ruf nach besseren Schutzstandards greift in Bolivien nicht ohne weiteres: es waren die Kinderselbstorganisationen, die gegen das Verbot von Kinderarbeit demonstrierten. Mit Erfolg: 2014 änderte die bolivianische Regierung das Gesetz und erlaubte Kinderarbeit ab zehn Jahren. Der ökonomische Druck der Familien ist so hoch, dass aus familiärer Sicht nicht auf das zusätzliche Verdienst der Kinder verzichtet werden kann. Die Kinder verdienen 2 bis 3 USD pro Tag (bzw. pro Nacht, damit sie tagsüber in der Schule anwesend sein können). Auch die Minenarbeiter gehen im vollen Bewusstsein der gesundheitlichen Gefahren in die Minen. Eine Untersuchung der Liga de Defensa del Medio Ambiente nahm Staub- und Blutproben rund um den „Cerro Rico“ und befand, dass der Staub sehr reich an Arsen, Kadmium, Quecksilber, Zink und Chrom war und alle Werte weit über den WHO-Grenzwerten lagen. Die Lebenserwartung der Menschen am Cerro Rico liegt bei 40 Jahren (Männer) bzw. 45 Jahren (Frauen).
Ein Bericht zur sozialen Lage Jugendlicher am Cerro Rico kam 2014 zum Schluss, dass die privaten Genossenschaften in Potosí den Arbeitern keine menschenwürdige Arbeit bieten, nicht in Sicherheit investieren und keinen Krankenversicherungsschutz bieten. Der Staat sei auf dem Cerro Rico völlig abwesend.
So frisst der Berg bis heute ungehindert seine Kinder!
Während die einheimische Bevölkerung sich im wahrsten Sinne des Wortes an den Resten des „Cerro Rico“ bis heute aufreibt, wurden Anfang des 21. Jahrhunderts reiche Silber-, Blei- und Zinkvorkommen im Departement Potosí entdeckt, die von internationalen Konzernen mit modernster Technologie erschlossen und ausgebeutet werden. Wie seit 500 Jahren fließen die Rohstoffe außer Landes und die Erträge kommen ausländischen Finanzinvestoren zugute. So wird die Mine San Cristóbal vom japanischen Industriekonzern Sumitomo betrieben und fördert täglich ca. 1300 Tonnen Silber-, Zink- und Bleikonzentrate. Die Mine ist die weltweit drittgrößte Silbermine und sechstgrößte Zinkmine. Die Region Petosí ist somit theoretisch weiterhin eine reiche Region mit einigen „Cerros Ricos“. Theoretisch … faktisch ist sie das ärmste Department im ärmsten Land Südamerikas.
Potosí steht sehr anschaulich für die Tatsache, dass Armut kein Schicksal ist, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Machtstrukturen, die sich seit 500 Jahren an den Profitinteressen eines kapitalistischen Systems ausrichten, sind der Grund für die anhaltend prekäre Situation vor Ort. Der Wohlstand im Norden bzw. Westen der Welt gründet nach wie vor auf der Ausbeutung des Südens. Was nach verstaubter marxistischer Kritik des Kapitals klingt, wird hier vor Ort sehr lebendig und konkret.

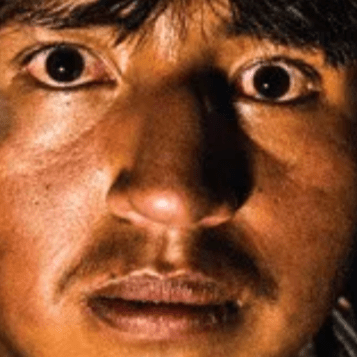
[…] Mit dem Grenzübertritt nach Bolivien begann somit eine neue Etappe unserer Reise: vom europäisch geprägten Teil Südamerikas in den deutlich indigeneren Teil des Kontinents, in dem der Kolonialismus deutlich stärker „gewütet“ (sprich: ausgebeutet) hat und die sozialen Folgen bis heute deutlich stärker zu Tage treten. Das ist umso absurder, als ausgerechnet auf dem Gebiet des heutigen Boliviens die Silberstadt Potosí liegt, einstmals die reichste Stadt der Welt. Bis heute verfügt Bolivien über Unmengen an wertvollen Ressourcen (von Silber über Zinn und Kupfer bis Lithium), die jedoch für jeden sichtbar nicht zum Wohlstand im Land selbst beitragen. Die weitere Reise verspricht ein Lehrstück in Sachen postkolonialer Ausbeutungsstrukturen zu werden. Daher bestand die Reiselektüre auf der Busfahrt auch aus dem Klassiker „Die offenen Adern Lateinamerikas“ von Eduardo Galeano. Doch dazu später mehr … (Blog #72 und Blog #73). […]
[…] etwas anders. Sie benötigten spätestens ab 1545 ein riesiges Arbeitskräftepotential, um die Silbervorkommen auszubeuten. Die Indios mussten mehr als 48 Stunden unter Tage arbeiten, „durchgehend ohne Nahrung und […]
[…] Gold- und Silberschätzen ungeahnter Größe verbunden haben (dazu gehört auch die Entdeckung des Silberbergs Potosí auf dem Gebiet des heutigen Boliviens). Der Ablauf der gewaltsamen Eroberung, der Übernahme der […]